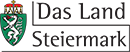Zum 100. Todestag Kaiser Franz-Josephs
Seine Regierungszeit, die Steiermark und die Steiermärkische Landesbibliothek
Der junge Erzherzog Franz Joseph
Der am 18. August 1830 im Schloß Schönbrunn geborene Sohn von Erzherzog Franz Karl (1802–1878) und Prinzessin Sophie Friederike von Bayern (1805-1878) erhielt als jüngster Spross des Hauses Habsburg-Lothringen bei der Taufe die Namen Franz Joseph Karl. Als Taufpate fungierte der Großvater Kaiser Franz I. (1768–1835), die Vornamen des späteren Kaisers sollten die Erinnerung an große Vorfahren des Erzhauses Habsburg wachhalten. Da der regierende Monarch Ferdinand I. (1793–1875) zum damaligen Zeitpunkt aufgrund seiner diversen gesundheitlichen Gebrechen weder ledig, noch mit Nachwuchs gesegnet war, stand die zukünftige Übernahme der Regierungsgeschäfte durch Franz Josef bereits von vornherein fest – und damit auch sein Ausbildungsprogramm.
Seine ersten Lebensjahre verbrachte er mit der als „Aja" (=Vorsteherin der Kindskammer) bezeichneten Luise Freiin von Sturmfeder (1789–1866), die als eine Art Kinderfrau für seine Erziehung und Versorgung bis zum sechsten Lebensjahr zuständig war. Bereits mit drei Jahren bekam der Prinz eine Uniform geschenkt und übte sich fortan in seiner schon damals eher knapp bemessenen Freizeit angeblich eifrig und begeistert im Exerzieren.
Ab dem sechsten Lebensjahr wurde die Erziehung Heinrich Franz Graf von Bombelles (1789-1850), einem Angehörigen eines ursprünglich aus Portugal stammenden Adelsgeschlechts, sowie Johann Baptist Alexius Graf Coronini von Cronberg (1794–1880) übertragen. Die Schulung des jungen Erzherzogs erfolgte nun nach den bereits von Josef II. (1741–1790) und Leopold II. (1747–1792) ausgearbeiteten Grundsätzen für die Ausbildung zum Kaiser. Die erste Fremdsprache, die der Erzherzog erlernte, war die italienische, danach kamen die französische und die ungarische an die Reihe; auch Tschechisch stand auf dem Lehrplan, um den jungen Thronfolger in möglichst umfassender Weise auf seine künftigen beruflichen Pflichten vorzubereiten.
Das Lernpensum wurde ab dem siebenten Lebensjahr von drei auf 18, und ab dem 12. Geburtstag auf 50 Unterrichtsstunden erweitert, wobei drei Stunden auf den Musikunterricht entfielen. Als 15-jähriger erhielt er bereits Unterweisungen in den Fächern "Rechts- und Staatswissenschaften" unter Berücksichtigung der "Moral" im Reich – jene Kernkompetenzen, die er als angehender "erster Beamter" seines Staatsgebietes dringend benötigte. Daneben wurden als weitere Schwerpunkte der Ausbildung die "realen" Fächer Physik, Biologie und Technologie unterrichtet, wie es vom ersten Kaiser aus dem Hause Lothringen eingeführt worden war. Besonders die naturwissenschaftlichen Neigungen des jungen Prinzen wurden durch seine Mutter gefördert, die in den Schönbrunner Gartenanlagen nicht zuletzt zu diesem Zweck eine eigene Menagerie mit diversen Vogel- und Kleintieren betrieb.
Da einem Staatsoberhaupt als militärischem Oberbefehlshaber auch die Verpflichtung zur Offizierslaufbahn – der Erzherzog Franz Joseph aufgrund seiner einschlägigen Interessen nur allzugerne nachkam – auferlegt war, kamen auch sportliche Unterrichtsgegenstände wie Reiten, Fechten, Gymnastik und Schwimmen nicht zu kurz.
Den Höhepunkt der Prinzenerziehung aber sollten die sonntäglichen Vorträge Fürst Clemens Wenzel Lothar Metternichs (1773–1859) in der Staatskanzlei darstellen, die den zukünftigen Herrscher auf die Kunst des Regierens – also die "hohe Politik" – vorbereiten sollten. Regelmäßige Studienreisen in diverse Kronländer zur Vertiefung des Gelernten sollten die umfassende Ausbildung des Thronfolgers abrunden.
Dieser aufwendige Erziehungsstil – verbunden mit einem dichtgedrängten und akkuraten Hofzeremoniell – bot dem jungen Erzherzog wenig Freiraum. Durch diesen bereits seit jeher übervollen Terminkalender wurde die Persönlichkeit des zukünftigen Herrschers zutiefst geprägt, was seinen Niederschlag im legendären Pflichtbewusstsein des späteren Monarchen – das bisweilen durchaus an Pedanterie grenzte – sowie der Regelmäßigkeit seines Tagwerkes finden sollten. Bekannt ist dabei seine Tugend der täglichen Schreibtischarbeit, seine Pflichtauffassung sowie seine sprichwörtliche Pünktlichkeit, Gründlichkeit und Genauigkeit, weshalb ihm nicht zu Unrecht nachgesagt wird, sein ganzes Leben als Kaiser sei ein "einziger Arbeitstag" gewesen – nur gelegentlich unterbrochen durch einen Theaterbesuch, ein paar Tage im Jagdrevier oder seltene Reisen, die ihn durchaus auch ins Ausland führen konnten. Urlaub im eigentlichen Sinne gab es demnach für Kaiser Franz Joseph I. nicht – denn auch in seinen "Feriendomizilen" wie Mürzsteg und Ischl dachte er niemals daran, seine staatsmännischen Pflichten zu vernachlässigen.
Situation 1848 im Habsburgerreich und die Thronbesteigung durch Kaiser Franz Joseph I
Die Thronübernahme durch den jungen Erzherzog erfolgte rascher als erwartet, als nach Unruhen in diversen Teilen der Monarchie – vor allem in Ungarn – am 13. März der konservative Verteidigungsminister Graf Theodor Latour (1780–1848) der bürgerlichen Lynchjustiz zum Opfer fiel. Auch die kaiserliche Familie war gezwungen, nach Olmütz zu emigrieren.
Am 22. Juli 1848 trat der konstituierende Reichstag in Wien zu einer Krisensitzung zusammen, wurde jedoch durch den Ausbruch neuerlicher Unruhen in Wien (wenn auch die Belagerung sowie Einnahme der Hauptstadt durch die kaiserlichen Truppen dank kroatischer Unterstützung letztlich erfolgreich war) am 22. Oktober 1848 nach Kremsier verlegt.
Das in der Fachliteratur auch als „Kremsierer Entwurf" bezeichnete Verfassungskonzept enthielt den Plan, alle "Erblande" – allerdings mit Ausnahme der Länder der ungarischen Krone sowie Lombardo-Venetien – zu einem übernationalen Reich zu vereinigen. Dieser Verfassungsentwurf besaß jedoch – aufbauend auf einer historischen Ländereinteilung – einen betont föderalistischen Charakter, denn die Kronländer sollten "zueinander im Verhältnisse der vollen Gleichberechtigung, zum ganzen Kaiserstaate, aber im Verhältnisse untrennbar organischer Bestandteile" stehen.
Obwohl der stets kränkliche Ferdinand I. – nicht umsonst nannte man ihn im Volksmund den "Gütigen" – bei seinen Untertanen äußerst beliebt war, gab er in einem bewegenden Staatsakt am 2. Dezember 1848 die Krone an seinen 18jährigen Neffen ab; froh, diese Last endlich loszuwerden, versicherte er ihm, es sei gern geschehen.
Durch die Auflösung des Reichstages durch den neuen Kaiser Franz Joseph I. am 4. März 1849 konnte der erwähnte Entwurf des Verfassungsausschusses im Plenum nicht mehr realisiert werden. Es wurde eine neue Verfassung ausgearbeitet – die sogenannte "Oktroyierte Märzverfassung"; diese umfasste alle Länder des Habsburgerreiches – und somit nun auch die Länder der ungarischen Krone, da deren Verfassung seitens der Krone durch den 1848 Aufstand als "verwirkt" erklärt wurde. Dieser Erlass teilte die Gesetzgebung zwischen dem Reich und den Ländern insoweit auf, als für den Bereich der Reichsangelegenheiten der Kaiser zusammen mit dem Reichstag zuständig sein sollte; in Landesangelegenheiten sollte dies in Gemeinschaft mit den Landtagen erfolgen.
Fürst Felix Schwarzenberg (1800–1852), der noch unter Kaiser Ferdinand I. am 21. November 1848 zum Ministerpräsidenten und zugleich zum Minister für Äußere Angelegenheiten und des kaiserlichen Hauses ernannt worden war, durfte diese Funktionen auch unter Kaiser Franz Joseph I. nach dessen Thronbesteigung behalten. Als Außenminister sah er schon voraus, dass die wachsenden Rivalitäten zwischen Preußen und dem Habsburgerreich sich auch auf die übrigen deutschen Länder politisch auswirken würden. Immerhin hatte Kaiser Franz Joseph I. bei seiner Thronübernahme ein heterogenes und fragiles Staatengebilde vorgefunden, das sich jederzeit zu einem Pulverfass entwickeln konnte.
Dem standen die jahrzehntelangen Entwicklungen in Preußen sowie in den anderen deutschen Staaten gegenüber, die nicht nur die Kräfte, sondern vor allem den Willen entwickelten, die möglichst umfassende politische Autonomie einzufordern.
Die Revolution in Deutschland des Jahres 1848 sollte schon die Bruchlinien im Bereich der Vorherrschaft über die deutschen Staaten zwischen Österreich und Preußen markieren. Es war auch schon absehbar, dass dies zu ernsthaften politischen Problemen in den beiden Staatsgefügen führen würde.
So hatte Außenminister Fürst Schwarzenberg schon 1849 die Aufnahme des Gesamtkomplexes der Habsburgermonarchie in den deutschen Staatenverbund gefordert, was einen Staatenkomplex mit 70 Millionen Einwohnern zur Folge gehabt hätte, verbunden mit einem enormen militärischen Reservoir. In der Frankfurter Nationalversammlung wurde dieser Vorschlag jedoch mit 290 zu 248 Stimmen zugunsten der "Kleindeutschen Lösung" abgelehnt sowie in der Folge dem preußischen König die erbliche Kaiserwürde angeboten. Damit hatten die Hohenzollern statt der Habsburger das politische Kommando im Deutschen Bund übernommen.
Eine bedeutende politische Rolle aus der Sicht der Steiermark spielte auch Erzherzog Johann (1782–1859), der in der Frankfurter Nationalversammlung – dem ersten gesamtdeutschen Parlament – Ende Juni 1848 zum Staatsoberhaupt, das den Titel Reichsverweser erhielt, gewählt wurde. Am 11. Juli 1848 zog er feierlich unter großer Begeisterung des Publikums in Frankfurt am Main ein.
In der Funktion des Reichverwesers galt er als provisorisches Oberhaupt eines im Entstehen begriffenen Deutschen Reiches mit der Befugnis, Reichsminister zu ernennen bzw. zu entlassen, aber auch Reichgesetze zu unterschreiben.
Nach dem die deutsche Revolution gewaltsam niedergeschlagen wurde, übertrug er am 20. Dezember 1849 die Befugnisse der Bundeszentralkommission.
Neoabsolutismus 1849-1859
Die Zeit nach den Revolutionsjahren 1848/49 bis zur Schlacht von Solferino 1859 war gekennzeichnet durch den sogenannten Neoabsolutismus.
Die Revolution des Jahres 1848 sollte entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft des Kaiserreiches bringen. Obwohl es der Regierung unter Kaiser Franz Joseph I. durch die Siege des Feldmarschalls Radetzky (1766–1858) gelang, die italienischen Aufstände niederzuwerfen, die Ungarn zu besiegen, und zusammen mit Preußen die Revolution zu meistern, hielt die innenpolitische Krise an.
Das erste gesamtösterreichische Parlament des Kaiserhauses Österreich, das in Wien und Kremsier als Reichstag gebildet wurde, hatte über Antrag des Abgeordneten Hans Kudlich (1823–1917) auch die Bauernbefreiung beschlossen.
Aber es war für die weitere Entwicklung verhängnisvoll, dass die Verfassung des Reichstages von Kremsier, durch die mit dem Willen der Völker die Vereinigten Staaten von Österreich geschaffen worden wären, mit der Niederlage der Revolution in Österreich ebenfalls zugunsten eines absolutistischen und streng zentralistischen Regimes aufgehoben wurde.
Die Niederschlagung des "Ungarnaufstandes" erfolgte am 13. August 1849 mit Unterstützung der russischen Armee bei Világos. Die Streitmacht der Verbündeten betrug insgesamt 275.000 Soldaten, während Ungarn 135.000 Mann stellte. Gegen die Revolutionsführer wurde ein Scharfgericht mit kriegsrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung gebracht. So wurden hohe Offiziere und Staatsbeamte, unter anderem auch der ungarische Ministerpräsident Graf Lajos Batthyány (1807–1849) hingerichtet.
Nach der Installierung der "Oktroyierten Märzverfassung" im Kremsierer Reichstag 1849 ging Kaiser Franz Joseph I. zielstrebig daran, die Ideen zur Rückkehr zum Absolutismus umzusetzen, wobei ihn der Präsident des Reichsrates Karl Baron von Kübeck (1780–1855), der die politische Philosophie eines konservativen Josephinismus vertrat, tatkräftig unterstützte.
Im August 1851 wurde die Ministerverantwortlichkeit aufgehoben, was bedeutete, dass sämtliche Minister nur mehr der Person des Herrschers gegenüber verantwortlich waren; mit dem "Silvesterpatent" vom 31. Dezember 1851 war von der "Oktroyierten Reichsverfassung" 1849 so gut wie nichts mehr vorhanden.
Freilich greift die Interpretation, damit sei eine Restauration des Absolutismus bzw. ein Obrigkeitsstaat installiert worden, der den Verhältnissen vor dem Revolutionsjahr 1848 entsprach, zu kurz.
Als Ergebnisse auf Dauer blieben vom Jahr 1848 die Einrichtungen der Gleichheit aller Staatsbürger, die Aufhebung der Grunduntertänigkeit sowie die Universitätsreform mit der Freiheit ihrer Lehre.
Ein zentrales Element für den Ausbau des Neoabsolutismus sollte die Reorganisation des österreichischen Verwaltungssystems durch den Wiener Advokaten und Innenminister Alexander Freiherr von Bach (1813–1893) darstellen, die durch die Abschaffung des Feudalsystems notwendig wurde und zu einer Zentralisierung der Verwaltung führte.
Dies erwies sich als umso unerlässlicher, als die Habsburgermonarchie seit jeher unter chronischer Geldnot litt und nur durch ständige Reformen ein akzeptables Budget zuwege brachte.
Eine weitere Stütze des Neoabsolutismus fand sich ohne Zweifel in der kaiserlichen Armee, da sie an verschiedenen Fronten gegen die Revolution eingesetzt wurde und sich damit nicht nur zu einem Hilfsmittel, sondern auch zu einem Symbol für die Legitimität – auch der Einheit der Monarchie – und für die Gegenrevolution entwickelte. Dass die Armee nicht nur die Funktion hatte, die Revolution niederzuschlagen, sondern auch den "inneren Frieden" zu verteidigen bzw. herzustellen, zeigt sich darin, dass bis September 1853 für die Städte Wien und Prag der Belagerungszustand verhängt wurde.
Die Verbundenheit der Habsburger-Monarchie mit den konservativen Strömungen, aber auch mit der Kirche – und damit die Gegnerschaft zum Liberalismus – zeigte sich im Konkordat von 1855, das in Form eines kaiserlichen Patents am 13. November veröffentlicht wurde und praktisch die Aufhebung des verordneten "Josefinischen Staatskirchentums" bedeutete, da die Vertreter der katholischen Kirche wiederum großen Einfluss auf das Familien-, Eherecht sowie den Bereich des Schulunterrichtes nehmen konnten.
Durch die veränderten Verhältnisse im Agrarbereich – nämlich die Grundentlastung und damit einhergehende Übergabe von Grund und Boden seitens des großgrundbesitzenden Adels bzw. der Katholischen Kirche an die Bauernschaft – gingen jahrhundertealte Traditionen, die beiderseitig das Bewusstsein geprägt hatten, verloren. Demzufolge wurden aus den ehemaligen Untertanen selbständige Eigentümer, die sich jetzt allerdings den freien Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage ausgeliefert sahen.
Krim-Krieg (1853–1856)
Nach dem Tode des Ministerpräsidenten und Außenministers Schwarzenberg am 5. April 1852 wurde Alexander Freiherr von Bach (1813–1893) sein Nachfolger, wobei Franz Joseph selbst alle Macht im Staate übernahm.
Die außenpolitischen Schwächen von Kaiser Franz Joseph I. und seinen Beratern zeigten sich schon im Verhalten während des Krimkrieges (1853–1856), in der das österreichische Kaiserreich seine Freundschaft mit Russland verspielte.
Den Anlass zum Krimkrieg bildeten die Ausweitung von wirtschaftlichen Einflusssphären im Osmanischen Reich, wobei einander die Westmächte England und Frankreich auf der einen und Russland auf der anderen Seite gegenüberstanden. Um die wahren Gründe zu verschleiern, wurde in propagandistischer Manier ein Zwist der christlichen Bekenntnisse um den Schlüssel der Grabeskirche in Jerusalem als "Ursache" vorgeschoben.
Die "politische Ungeschicklichkeit" der Habsburgermonarchie fand ihren Ausdruck darin, dass es sich nominell "neutral" gegenüber Russland verhielt, aber am 3. Juni 1854 den Zaren aufforderte, sich aus den "Donaufürstentümern" Moldau und Walachei zurückzuziehen. Im Herbst 1854, nach dem Abzug der russischen Armee, besetzte es diese Gebiete und stationierte 300.000 Mann an der russischen Grenze. Der Friede von Paris am 30. März 1856 zwischen dem Osmanischen Reich, den Verbündeten Frankreich, Großbritannien und Sardinien (seit 1885) einerseits und Russland andererseits beendete den Krimkrieg.
In außenpolitischer Hinsicht hatte sich die Habsburgermonarchie damit in eine "politische Isolierungshaft" hineinmanövriert, was in weiterer Folge Auswirkungen auf künftige Kriegsschauplätze wie Sardinien zeitigen sollte.
Meilensteine: Schlacht bei Solferino 1859
Schon im Ersten Sardinischen Krieg von 1848/49 gab es in den italienischen Provinzen der Habsburgermonarchie, Lombardei und Venetien, die ersten Ausschreitungen. Am Neujahrstag des Jahres 1848 ereigneten sich im Habsburgischen Kaiserreiche auf italienischem Boden, nämlich in Mailand, revolutionären Tumulte. Politisches Ziel dieser Vorkämpfe für die Einigung Italiens war die Schädigung von Staatseinnahmen durch den Boykott, österreichische Tabakwaren zu kaufen und wird daher auch als "Mailänder Zigarrenrummel" bezeichnet.
Obwohl Feldmarschall Radetzky später mit Siegen bei Santa Lucia bei Verona am 6. Mai und letztlich am 25. Juli bei Custozza den Aufruhr endgültig niederschlagen konnte, griffen die Unruhen auch auf das österreichische Staatsgebiet über.
Der Sardinische Krieg bzw. Zweite Unabhängigkeitkrieg hatte seinen realpolitischen Hintergrund in der Unterstützung von italienischen Freiheitskämpfern in den italienischen Habsburgerprovinzen Lombardei sowie Venetien durch das sardische Königreich unter Viktor Emanuel II. Auch der französische Kaiser Napoleon III. (1808–1873) sicherte den Freischärlern jegliche Hilfe zu, wo ihm seit jeher sehr daran gelegen war, die unliebsame Donaumonarchie wenn schon nicht als Konkurrenten auszumerzen, so doch zumindest möglichst zu destabilisieren.
Den Anlass zu dieser militärischen Auseinandersetzung lieferte eine vorbereitete Entscheidung des Wiener Hofes, in den oberitalienischen österreichischen Besitzungen – Provinzen Venetien und Lombardei – die Wehrpflicht einzuführen, worauf es tausende Wehrdienstpflichtige vorzogen in das benachbarte Königreich Sardinien-Piemont zu desertieren.
Die Forderung des Wiener Hofes von April 1859 an den Ministerpräsidenten Graf Camillo Cavour (1810–1861), die Fahnenflüchtigen auszuliefern, wurde abgelehnt, sodass ein Krieg unvermeidlich erschien, insbesondere, weil im sardisch-französischen Geheimabkommen von Plombières-les-Bains vom 20. Juli 1858 die beiden Vertragspartner übereingekommen waren, einen Krieg gegen die Habsburger anzuzetteln. Die Auseinandersetzung begann mit einem Ultimatum seitens der Habsburgermonarchie am 23. April 1859 an das Königreich Sardinien-Piemont, in dem das Königreich zur Demobilisierung und die Entwaffnung des Garibaldi'schen Freikorps binnen weniger Tage aufgefordert wurde, was einer Kriegserklärung gleichkam.
Die Armee des österreichischen Kaisers marschierte am 29. April unter dem Oberbefehl des Grafen Ferencz József Gyulay (1798–1868) in drei Gebiete von Piemont ein.
In der am 4. Juni 1859 stattfindenden Schlacht von Magenta wurden die österreichischen Truppen vom vereinigten französisch-sardischen Heer bezwungen, sodass König Viktor Emanuel und Kaiser Napoleon III. unter Jubel der Bevölkerung am 8. Juni in Mailand einziehen konnten.
Am 24. Juni 1859 stießen bei Solferino – Kaiser Franz Joseph I. hatte nominell das Oberkommando inne – Armeen in der Truppenstärke von 151.200 Mann seitens Sardiniens und Frankreichs und 133.250 Mann seitens des österreichischen Kaiserreiches nochmals aneinander.
Bei dieser Schlacht kamen die Truppen des österreichischen Kaisers völlig unter die Räder; in diesem blutigen Debakel waren 22.350 Tote und Verwundete auf österreichischer Seite, 5.500 auf italienischer und 12.000 auf französischer Seite zu beklagen.
Die beiden Kriegsgegner lenkten aufgrund der "offensichtlichen" Sinnlosigkeit weiterer militärischer Aktionen daraufhin ein; so konnten Kaiser Franz Joseph I. und Napoleon III. am 11. Juli 1859 einen Waffenstillstand und Vorfrieden von Villafranca unterzeichnen.
Darauf folgte der Friede von Zürich (10. November 1859), der Österreich verpflichtete, die Lombardei – ohne Mantua und Peschiera – an den französischen Kaiser abzutreten. Dieser würde es dann weiter Piemont-Sardinien überlassen und dafür, wie vereinbart Savoyen und Nizza (1860) erwerben.
Auch die habsburgischen Sekundogenituren in der Toskana und Modena lösten sich durch Volksabstimmung vom Kaiserreich, sodass vom italienischen Besitz nur mehr Venetien übrigblieb.
Österreich ging also außerordentlich geschwächt aus diesem Krieg hervor – es war der Beginn des Zerfalls des einstmals stolzen Kaiserreiches.
Die Ursache für die unheilvolle Außenpolitik im Sardinischen Krieg zwischen dem österreichischen Kaiserstaat und dem Königreich Sardinien bzw. dem verbündeten Frankreich unter Napoleon III. lag in der falschen Einschätzung des strategisch unerfahrenen jungen Kaisers Franz Joseph, wonach die italienischen Besitzungen mit den Feldzügen von 1848 und 1849, die mit den Siegen Radetzkys endeten, als befriedet zu betrachten seien.
Deutscher Bund - Königgrätz und Ausgleich
Kaiser Franz Josephs Versuche zur Reform des Deutschen Bundes
Der Versuch des österreichischen Kaiserreichs, eine Reform des Deutschen Bundes wieder in Schwung zu bringen, sollte im August 1863 seinen Höhepunkt finden, als Kaiser Franz Joseph I. einen Fürstentag in Frankfurt am Main einberief, um die ausgearbeiteten Reformen beschließen zu lassen.
Auf der Tagesordnung der Reformagenda befand sich: die Bildung eines Fünferdirektoriums, bestehend aus Österreich, Preußen, Bayern sowie zwei von den Fürsten zu wählenden Mitgliedern, die Bildung eines föderativen Bundesrates mit je drei Stimmen für Österreich und Preußen, Vorsitz Österreichs in Direktorium sowie Bundesrat, beratende Versammlung von Delegierten der Landtage im dreijährigen Turnus, Einrichtung eines Obersten Bundesgerichts.
Ohne weiter näher auf die rechtliche Konstruktion einzugehen, befürchtete Preußen, diese Art der politischen Gestaltung könnte leicht zu einer Majorisierung gegen ihre Interessen führen. Obwohl Kaiser Franz Joseph I. den Hohenzollern-König Wilhelm I. (1797–1888) persönlich aufsuchte, um ihn zur Teilnahme am Fürstentag zu bewegen, gelang es Bismarck mit seinen Überzeugungskünsten, dass er dem Fürstentag fern blieb.
1866 Königgrätz
Nach den Niederlagen in Italien sollte sich die außenpolitische Situation des Habsburgerreiches in nachhaltiger Weise verändern und sich insbesondere bei der Frage Schleswig-Holstein radikalisieren.
Durch die Frage, in welcher Form die Herzogtümer Schleswig und Holstein innerhalb des Deutschen Bundes eingebunden werden sollten, wurde die Sachlage politisch kritisch. Die österreichische Position ging davon aus, dass Schleswig-Holstein als selbständiger Staat im Deutschen Bund zu begreifen sei, während Preußen die beiden Territorien als annektierbare Ländereien ansah.
Ein gemeinsames politisches und militärisches Vorgehen der beiden Großmächte erfolgte noch gegen das Königreich Dänemark, denn im dänischen Reichstag wurde 1863 eine Verfassung verabschiedet, die die Einverleibung Schleswigs vorsah. Proteste seitens Österreichs und Preußens, diese Verfassung zurückzunehmen, wurden seitens Dänemarks abgelehnt, sodass beide am 1. Februar 1864 eine Kriegserklärung an Dänemark richteten.
Eine bedeutende Rolle in diesem Krieg spielte die österreichische Kriegsflotte, die unter dem Kommando von Admiral Wilhelm von Tegetthoff stand und die Dänen bei Helgoland am 9. Mai 1864 niederkämpfte.
Im Frieden von Wien-Schönbrunn vom 30. Oktober 1864 wurden die Gebiete der Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg den beiden Großmächten zur gemeinsamen Verwaltung überlassen, während in der Gasteiner Konvention vom 20. August 1865 die politischen Gegensätze nochmals insoweit überwunden werden konnten, als sich das österreichische Kaiserreich auf die Verwaltung Holsteins beschränkte und man sich drauf verständigte, das Herzogtum Lauenburg gegen eine Zahlung von 2,5 Millionen Dänischer Taler dem Königreich Preußen zu übertragen.
Die eigentliche Frage, die sich hinter diesem Konflikt verbarg, war jene nach der Vorherrschaft im Deutschen Bund bzw. der Entstehung eines neuen deutschen Einheitsstaates, aber auch das Problem, welche Großmacht definitiv dessen Vorsitz übernehmen sollte. Dem preußischen Ministerpräsidenten Graf Bismarck schwebte hier eine sogenannte "Kleindeutsche Lösung" vor, d.h. ein deutsches Reich, das von Berlin aus regiert werden sollte – ohne politische Einbindung des Habsburgerreiches.
Im Habsburgerreich hingegen wurde die "Großdeutsche Lösung" präferiert, die eine Wiedererrichtung eines gemeinsamen Großreiches plante – eine Lösung, die eine Restauration des Zeitalters vor Napoleons vorsah und demnach seine Zentrale in der Kaiserstadt Wien haben sollte.
Diese militärische Unternehmung wurde gründlich vorbereitet, denn am 8. April 1866 schloss Bismarck mit dem Königreich Italien einen Geheimvertrag, wobei sich beide Staaten zusicherten, an das Habsburgerreich den Krieg zu erklären sowie keinen Sonderfrieden schließen zu wollen. Realpolitisch bedeutete dies, dass Österreich gezwungen werden sollte die venezianisch-lombardischen, aber auch südslawische Gebiete abzutreten, während sich Preußen die Erwerbung gleichwertiger österreichischer Länder – es wurde von Böhmen gesprochen – sowie die Annexion innerhalb Deutschlands vorbehielt.
In der Zwischenzeit war es den Preußen gelungen, die Völker der österreichischen Monarchie gegen die Regierung aufzuwiegeln. So wurde etwa angedacht, eine "Ungarische Legion" im Rahmen der preußischen Armee einzuberufen; ebenso gab es Pläne, serbische und rumänische Freischärler zu rekrutieren, die im Kaiserreich einfallen und somit Österreich "ins Herz treffen" sollten.
Auch Österreich unterzeichnete mit Napoleon III. am 12. Juni desselben Jahres einen Neutralitätsvertrag, der Österreich ohne Rücksicht auf Ausgang des österreichisch-preußischen Konfliktes verpflichtete, Venetien zu räumen. Damit gingen sämtliche italienischen Provinzen für die Habsburgermonarchie verloren.
Im Frühsommer des Jahres 1866 brach der endgültige offene Streit über die Frage der gemeinsamen Verwaltung von Schleswig-Holstein los, sodass zur Lösung dieser Frage der Deutsche Bund im Juni 1866 einberufen wurde und Österreich die Bundesexekution gegen Preußen beantragte, dem dieser dann auch zustimmte.
In der Zwischenzeit waren die preußischen Truppen in Holstein einmarschiert und Bismarck sah darin eine Art innerdeutscher Kriegserklärung, sodass er den Deutschen Bundestag für aufgelöst erklärte, wobei nach Art. I der Bundeakte dies unzulässig war, da der Deutsche Bund als "unauflöslicher Verein" anzusehen war.
Auf Seite der österreichischen Monarchie bei den kriegerischen Auseinandersetzungen standen die größeren deutschen Staaten wie Bayern, Württemberg, Baden, Sachsen, Hessen-Kassel und Hannover, wobei die militärische Hilfe als weitaus zu gering einzustufen war. So besiegte die preußische Armee zuerst die Hannoveranischen und dann die bayrischen Truppen.
An der Südfront – wie im Geheimvertrag mit den Preußen abgesprochen – erklärten die Italiener Österreich den Krieg. Das kaiserliche Heer von Erzherzog Albrecht von Österreich-Teschen (1817–1895) konnte am 24. Juni 1866 bei Custozza die weit überlegene italienische Armee unter dem Oberbefehl von König Viktor Emanuell II. besiegen und am weiteren Vormarsch hindern. In der Schlacht zwischen der österreichischen sowie der italienischen Flotte am 20. Juli 1866 vor der dalmatinischen Insel Lissa konnte Admiral Wilhelm von Tegetthoff (1827–1871) einen Seesieg erzielen.
Den Hauptkriegsplatz sollte jedoch Böhmen darstellen. Obwohl die gesamten sächsischen Truppen mit dem österreichischen Heer vereinigt waren und tapfer an dessen Seite kämpften, sollte diese Allianz, die am 3. Juli 1866 stattfindende Schlacht bei Königgrätz gegen das preußische Heer verlieren.
Die Österreichisch-Ungarische Monarchie- der Ausgleich
Das Jahr 1866 stellte eine Zäsur in der Außenpolitik des Habsburgerreiches durch Franz Joseph I. dar, denn im Kontext mit der Entscheidung von 1866 standen auch die Vorbereitungen zur Bildung des preußisch-kleindeutschen Nationalstaates als auch die entscheidenden politischen Bausteine für die Einigung des italienischen Staates. Mit Gründung des "Deutschen Kaiserreiches" im Jahre 1871 im Spiegelsaal des Versailler Schlosses unter Führung Preußens mit Kaiser Wilhelm I. von Hohenzollern (= Wilhelm II. von Preußen) wurde das Österreichische Kaiserreich zwar nicht offiziell der Hegemonie Berlins unterstellt, ging aber aus wirtschaftlichen Gründen und angesichts seiner politischen Instabilität faktisch seiner Vormachtstellung verlustig.
Durch das Ausscheiden Österreich aus dem Deutschen Bund durch den erwähnten Frieden von Nikolsburg am 26. Juli 1866 und den Friedenschluss am 23. August 1866 in Prag gestaltete sich die Politik mit Ungarn schwierig.
Nachdem Friedrich Ferdinand Graf Beust (1809–1886) Außenminister wurde, folgten unter Vermittlung von Kaiserin Elisabeth im Oktober 1866 Verhandlungen mit Graf Julius Andrássy (1823–1890) und Franz Déak (1803–1876), die den Weg zum Ausgleich mit Ungarn führen sollten. Als Resultat entstand die Österreichisch-Ungarische Monarchie – diese bestand aus zwei Staaten, die im Volksmund als "Österreich" und "Ungarn" bezeichnet wurden, während die amtlichen Namen "Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder" und "Die Länder der Heiligen Ungarischen Krone" lauteten. Als geographische Trennungslinie wurde der Leithafluss herangezogen, weshalb man auch von einer cisleithanischen und einer transleithanischen Reichshälfte sprechen konnte.
Die beiden Staaten, in Österreich als "Reichshälften" bezeichnet, standen in staatsrechtlicher Hinsicht in "Realunion", wodurch sich auch die Benennung "Doppelmonarchie" einbürgerte.
Dabei besaßen beide Staaten eigene Parlamente sowie verfassungsmäßige Einrichtungen mit folgenden Gemeinsamkeiten: Das Staatsoberhaupt, das in Österreich den Titel eines Kaisers, in Ungarn den Titel eines Königs führte. Gemeinsame Außenpolitik – es gab einen einzigen österreichisch ungarischen Außenminister, nur österreichisch-ungarische Botschaften, Gesandtschaften und Konsulate im Ausland. Das gemeinsame Heer und die gemeinsame Kriegsflotte – als Kommandosprache fungierte Deutsch, als Regimentssprache jene Sprache, der die Mehrheit der Soldaten des betreffenden Regiments angehörte. Weiters gab es neben dem gemeinsamen österreichisch-ungarischen Kriegsminister noch einen österreichischen Landesverteidigungs- sowie einen ungarischen Honvédminister; denn in der Reserve, in der sogenannten "Landwehr" und in den "Honvéds", waren die beiden Staaten getrennt. Gemeinsam blieb auch jener Teil der Finanzen, der für die Finanzierung der gemeinsamen Angelegenheiten notwendig war, sodass es einen gemeinsamen österreichisch-ungarischen, einen österreichischen und einen königlichen ungarischen Finanzminister gab.
Krönung in Ungarn (1867)
Mit 24 Jahren hatte der junge Kaiser seine entfernte Verwandte Elisabeth (1842–1898) vor den Traualtar geführt. Die Ehe verlief zunächst harmonisch, bis die beiden eine ihrer Töchter im Alter von zwei Jahren durch eine Typhuserkrankung verloren.
Auch die spätere Geburt des lang ersehnten Kronprinzen Rudolf (1858–1889) machte die Entfremdungstendenzen nicht viel besser, zumal sich Elisabeth nicht mit ihrer Schwiegermutter verstand.
Fortan gingen die beiden ihre eigenen Wege – der Kaiser ging in seinem übervollen Terminkalender auf, während sich die Gemahlin die meiste Zeit auf Reisen befand; nach dieser rund zweijährigen Pause fand sie wieder die nötige Kraft, das strikte Hofzeremoniell durchzustehen.
Erst 1867 – im Zuge der Verselbständigung der Transleithanischen Reichshälfte – sollte es zu einem bedeutsamen Auftritt der beiden in der Öffentlichkeit kommen. Die damit verbundene Krönung des Herrscherpaares in Ungarn fand am 8. Juni 1867 in der Matthias-Domkirche zu Budapest statt.
Die Salbung des Monarchen erfolgte durch den Cardinal-Erzbischof von Esztergom und Fürst-Primas von Ungarn, János Simor (1813–1891). Ministerpräsident Julius Graf Andrássy setzte Franz Joseph I. in seiner Funktion als stellvertretender Palatin von Ungarn in der Folge die Krone des Hl. Stephan auf das Haupt und krönte ihn zum Apostolischen König von Ungarn, worauf er nach alter Sitte die Krone über die Schulter Elisabeths hielt und damit auch diese zur Apostolischen Königin von Ungarn erhob.
Als Dank und Anerkennung für den Abschluss des Ausgleichs des Kaisertums Österreichs mit Ungarn seitens des ungarischen Volkes erhielt das Kaiserpaar das Schloss Gödöllö, für das Elisabeth bei einem früheren Besuch geschwärmt hatte, als Sommersitz.
Franz Josephs Spuren in der Steiermark
Die Spuren Kaiser Franz Josephs I. in der Steiermark lassen sich auch an seiner Jagdleidenschaft in steirischen Revieren deutlich dokumentieren.
Zuvorderst ist das Anwesen in Neuberg an der Mürz zu nennen, ein 1786 aufgehobenes Zisterzienserstift mit seinem bedeutenden und großen gotischen Kirchentrakt. Dabei wurde der südöstliche Trakt des ehemaligen Stiftsgebäudes zum Jagdschloss mit entsprechender Einrichtung umgestaltet; bis 1870 war Neuberg ein Revier, das Franz Joseph I. besonders im Frühling zur Hahnenbalz und im Herbst zur Hochwildjagd aufsuchte.
Ein weiteres Revier mit Jagschloss befindet sich in Mürzsteg und wurde 1869 vom Kaiser in Auftrag gegeben. Die Planung des im Schweizer Stil errichteten Landhauses erfolgte durch das Wiener Architektenduo August Schwendenwein von Lanauberg (1817- 1885) und Johann Romano von Ringe (1818–1882); das Gebäude wurde in den Jahren 1879 und 1903 deutlich umgebaut bzw. erweitert.
Diesem Schlosse kommt seit dem Jahre 1947 die Ehre zu, als Sommersitz des jeweils amtierenden Bundespräsidenten zu fungieren.
Im Jahre 1903 erhielt das Mürzsteger Jagdhaus hohen politischen Besuch durch Zar Nikolaus II. (1868–1918), der schon 1902 den Wunsch geäußert hatte, im wunderbaren Gemsenrevier jagen zu dürfen.
Die offizielle Einladung hierfür war im Frühjahr desselben Jahres erfolgt; nach einem Zwischenstopp in Wien am 30. September fuhren die Monarchen gemeinsam und in Begleitung des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand (1863–1914) im Hofsonderzug nach Neuberg, um von dort mittels Pferdekutschen in das steirische Revier gebracht zu werden.
Auf diese Art der Beförderung legte der Kaiser zeitlebens großen Wert, denn dem Automobilismus gegenüber hegte er ein unverrückbares Misstrauen.
In seinem Gefolge befanden sich unter anderem auch der russische Außenminister Graf Wladimir Nikolajewitsch Lambsdorff (1844–1907) und sein österreichischer Amtskollege Graf Agenor Goluchowski (1849–1921), die beide mitgereist waren, um die "mazedonische Frage" auf diplomatischer Ebene zu beraten. Schon seit 1897, dem Besuch Kaiser Franz Josephs I. in St. Petersburg, gestaltete sich ein konstruktives Politikverständnis der beiden Kaiserreiche in Hinblick auf gemeinsame Richtlinien für den Balkanbereich. Diese Richtlinien sollten sich in den "Mürzsteger Beschlüssen" konkretisieren, die die Einleitung von gemeinsamen Reaktionen zum Ziel hatten. Um die Lage in diesem ethnisch inhomogenen Gebiet zu beruhigen, sollte auch das Osmanische Reich Reformen unter internationaler Aufsicht zustimmen. Somit handelt es sich um einen Ansatz des internationalen Krisen- und Konfliktmangements, wie heute als „peace-building" oder „state-building" geläufig.
Diese Übereinstimmung der beiden am Balkan meist interessierten Mächte in Bezug auf den Status quo wirkte sich auf die Balkanvölker, besonders auf den serbischen Nationalismus, zwar beruhigend aus, konnten aber die Eskalation ein gutes Jahrzehnt später trotzdem nicht verhindern.
Familiäre Schicksalsschläge
Eine Reihe von familiären Schicksalsschlägen sollten die Regierungszeit Franz-Josephs I. überschatten: Bei einer Ungarn-Reise nach Budapest verstarb am 29. Mai 1857 Erzherzogin Sophie Friederike, 1867 wurde sein Bruder Maximilian beim mexikanischen Abenteuer bei Querétaro erschossen.
Am 30. Jänner 1889 überschattete der Freitod von Kronprinz Rudolf mit seiner 17-jährigen Geliebten, Marie Alexandrine Freiin von Vetsera (1871–1889), in Mayerling den Schatten des Hauses Habsburg und führten zu einem Skandal, der insbesondere durch die Medien geschürt wurde.
Am schwersten sollte den Kaiser jedoch der Tod seiner Gemahlin Elisabeth treffen. Diese wurde am 10. September 1889 in Genf – vor ihrer Reise nach Caux, auf dem Steg der Dampferanlegestelle – vom italienischen Anarchisten Luigi Luccheni mit einer Feile, die er ihr ins Herz stach, erstochen. Bei der Todesnachricht, die der Kaiser per Telegramm erhalten hat, soll er gesagt haben: "Mir bleibt doch gar nichts erspart auf dieser Welt!"
"Drei-Kaiser-Abkommen" – Der Zwei- bzw. Dreibund 1879
Nach dem Berliner Kongress des Jahres 1878 begannen sich die Konturen einer innen- und außenpolitischen Neuorientierung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie abzuzeichnen. In der Innenpolitik übernahm im August 1879 Ministerpräsident Graf Eduard Taaffe (1833–1895) die Regierungsagenden und fand Unterstützung beim feudal-konservativen Hohenwartklub, der Tschechischen Nationalpartei und den deutschen, slowenischen sowie italienischen Klerikal-Konservativen. Diese "rechte" Regierung mit einer konservativ-slawischen Mehrheit wurde als "Eiserner Ring" bezeichnet und hielt bis 1893.
Kennzeichnend für den politischen Stil der Ära Taaffe war, dass für diesen die Begriffe des "Fortwurstelns" bzw. "Durchfrettens" geprägt wurden. Dies entsprach durchaus auch dem Empfinden Kaiser Franz Josephs, für den Ruhe und Kontinuität als vorrangig für die Erhaltung des politischen Friedens bzw. für die Aufrechterhaltung der Rolle als Großmacht für die Monarchie zu gelten hatte.
Ausgangspunkt der Überlegungen Reichkanzler Otto von Bismarcks waren das Deutsche Reich mit Hilfe einer komplizierten Bündnispolitik eine Einbindung in das internationale Staatensystem zu gewährleisten.
Die Grundüberlegungen setzten dabei an, dass es eine Koalition der "Verlierer" – Österreich-Ungarn 1866 und Frankreich 1870/71 – zu verhindern galt, als auch einen politischen Handlungsspielraum gegenüber dem Zarenreich zu gewinnen, sodass Bündnisse mit Österreich-Ungarn und Russland als zweckmäßig erschienen.
Diesen Grundprinzipien entsprechend fand in September 1872 ein Treffen in Berlin mit Wilhelm I., dem österreichischen Kaiser Franz Joseph I. sowie dem russischen Zar Alexander II. (1818–1881) statt, in dem als gemeinsame Zielsetzung der Erhalt der monarchischen Staatsform bekundet wurde. Eine Militärkonvention wurde im Juni 1873 seitens Franz Joseph I. und Alexander II. unterzeichnet und gipfelte im "Drei-Kaiser-Abkommen" durch den Beitritt Deutschlands im Oktober 1873. In diesem Abkommen verpflichteten sich die beteiligten Staaten, einander im Falle eines Angriffes durch eine fremde Macht ohne Suche nach anderen Bündnissen oder Abschlüsse neuer Abkommen zu verständigen.
Um sich einen "politischen Spielraum" im russischen Einflussbereich offenzuhalten, handelten der Außenminister von Österreich-Ungarn, Graf Gyula Andrássy (1823–1890) mit Reichskanzler Bismarck ein geheimes Defensivbündnis gegen Russland aus, das am 7. Oktober 1879 in Vertragsform abgeschlossen wurde.
Dabei wurde eine gegenseitige militärische Hilfsverpflichtung im Falle eines russischen Angriffes eines Bündnispartners vereinbart; als Bündnisfall galt auch, wenn einer der beiden Vertragspartner mit dem russischen Reich verbündet wäre bzw. russische Unterstützung erhalten sollte. Im Falle eines Angriffes einer sonstigen Macht sollte gemäß Vertrag eine gegenseitige wohlwollende Neutralität eintreten, die jedoch eine aktive Hilfe auslösen sollte, wenn der Aggressor russische Unterstützung erlangen sollte.
Eine Erweiterung des "Zweibundes" fand 1882 durch den Beitritt Italiens zum "Dreibund" statt, die bis 1918 bzw. 1914 vertragliche Gültigkeit besitzen sollten, da der "Dreibund" bei Kriegseintritt von Italien auf Seiten der Entente gegen die Mittelmächte obsolet wurde.
Die ständigen Spannungen zwischen dem Zarenreich Russland und dem Kaiserreich Österreich-Ungarn wegen der Balkanfrage sollten sich soweit verschlechtern, dass 1887 eine Verlängerung des "Drei-Kaiser-Bündnisses" nicht mehr möglich war.
Nachdem Russland im April 1877 der Hohen Pforte – dem Osmanischem Reich – den Krieg erklärt hatte, drohte der Balkankrieg sich zu einer internationalen Kontroverse zwischen den Großmächten auszuwachsen, da die politischen Interessenskonflikte zwischen dem Russischen und dem Habsburgischen Reich nach dem Vorfrieden von San Stefano (3. März 1878) als unüberbrückbar erschienen und noch dazu die Gründung eines Großbulgarischen Reiches in Aussicht stand, das beinahe die gesamte Balkaninsel umfassen sollte.
Durch den Friedensvertrag, der Gebietsabtretungen seitens der Türkei einhergehen sollte, sollten Serbien, Montenegro und Rumänien vergrößert und autonom werden. Bulgarien sollte durch die Gebiete Ostrumelien (Balkan-Türkei) und Mazedonien erweitert werden, wodurch das vorhin erwähnte Großbulgarisches Reich entstanden wäre.
Sowohl Österreich-Ungarn – aus Sorge um die wachsende russische Einflusssphäre an der südöstlichen Flanke – als auch Großbritannien, das eine Politik des Mächtegleichgewichtes in Europa verfolgte, protestierten gegen dieses Vorgehen seitens des Zarenreiches.
Da keine politischen Interessenslagen am Balkan seitens des deutschen Kaiserreiches gegeben waren, erklärte sich Reichskanzler Otto von Bismarck bereit als "ehrlichen Makler" einen Friedenskongress zu leiten, der in der Reichshauptstadt Berlin stattfinden sollte.
Im Juni 1878 wurde seitens des Berliner Kongresses der Großmächte Österreich-Ungarn die Genehmigung zur Okkupation der Balkanprovinzen Bosnien und Herzegowina erteilt. Als Ziel dieser – als völkerrechtlich schwierig und verworren einzustufenden – Lösung galt, dass die beiden Provinzen von der k. u. k. Armee besetzt und durch Österreich-Ungarn verwaltet werden, aber weiterhin unter türkischer Oberhoheit stehen sollten, wobei sich auch Sultan Abdul Hamid II. mit dieser Vorgangsweise einverstanden zeigte.
Bosnien und Herzegowina waren seit dem 15. Jahrhundert Teile des Osmanischen Reiches; der Großteil der Bevölkerung gehörte zu den Slawen und 36 Prozent zu den Muslimen. Mit dem Schwinden der Macht der Osmanen sah man seitens des Westens angeblich die Möglichkeit, die Unterdrückung der christlichen Bewohner durch die Sultane oder Großwesire zu unterbinden.
Der Einmarsch der Armee erfolgte am 29. Juli 1878 und war von heftigen Widerständen seitens der Bevölkerung begleitet, sodass Sarajevo erst am 19. August erstürmt werden konnte; Mostar konnte erst am 16. Oktober erobert werden.
Die Stimmung seitens der Bevölkerung gegenüber Österreich-Ungarn blieb stets gespannt, obwohl die Regierung die Infrastruktur in teils kargen Gebirgsgegenden großzügig errichtete und ausbaute.
Den Ideen der (seiner) Bündnispolitik folgend, schloss Reichskanzler Bismarck am 18. Juni 1887 mit dem Zarenreich einen geheimen Rückversicherungsvertrag ab, mit dem Ziel, die Neutralität des Deutschen Reiches bei einem Angriff des Habsburger Reiches auf Russland und im Gegenzug dessen Neutralität im Falle eines Angriffs Frankreichs auf das deutsche Kaiserreich, zu gewährleisten.
Veranlasst durch den Wunsch des zukünftigen Thronfolgers Franz Ferdinand, eine "aktive Außenpolitik" zu betreiben, wandelte Wien 1908 unter dem k. u. k. Außenminister Alois Freiherr Lexa von Ährenthal (1854–1912), die Okkupation von Bosnien und der Herzegowina in eine Annexion um, sodass die Provinzen als Besitztümer des Hauses Habsburg der Monarchie einverleibt wurden.
Dieser völkerrechtliche Fehlgriff führte zu heftigen Protesten seitens führender politischer Gestalten der Großmächte. Selbst Kaiser Wilhelm I. (1859–1941), der deutsche Verbündete, zeigte sich darüber verärgert, sodass sich die Wiener Regierung entschließen musste, eine Kompensationszahlung von zwei Millionen Pfund Sterling an den Sultan in Istanbul zu leisten.
Durch die offensive Balkanpolitik von Österreich-Ungarn sah sich das Königreich Serbien zunehmend ins politische Abseits gedrängt. Als wichtigste Ursache für die wirtschaftliche Existenzbedrohung galt hier der sogenannte "Schweinekrieg", wobei die Wiener Regierung einen überhöhten Zollsatz für die Einfuhr von Schweinefleisch festlegte, sodass ungarische Züchter die unerwünschte Konkurrenz loswurden.
Dem gut informierten serbischen Geheimdienst blieb auch nicht verborgen, dass bereits seit 1907 Pläne für den Präventivkrieg gegen Serbien existierten, die Generalstabchef Franz Conrad von Hötzendorff (1852–1925) ausgearbeitet hatte, wonach Serbien zusammen mit anderen Balkan-Provinzen zum Bestandteil einer "südslawischen Habsburger-Monarchie" werden sollte. Daneben galt als erwiesen, dass konservative Kreise am Kaiserhof zu Wien eine Aufteilung Serbiens zwischen Österreich-Ungarn und dem russischen Zarenreich als eine zielführende politische Problemlösung des "Pulverfasses Balkan" ansahen.
Die serbische Regierung in Belgrad wandte sich daraufhin an den "großen slawischen Bruder", nämlich Russland, um Hilfe und der Zar sagte für den Ernstfall seine Unterstützung auch zu.
Im Frühsommer 1914 wurde der Thronfolger Franz Ferdinand durch ein Attentat seitens eines serbischen Anarchisten ermordet, was eine Kettenreaktion bis hin zum Ersten Weltkrieg auslöste.
Nationalitätenproblem
Das Nationalitätenproblem im Balkanbereich hatte eine besondere Ausprägung und sollte sich zur Existenzfrage der österreichisch-ungarischen Monarchie entwickeln. So fand schon im Revolutionsjahr 1848 ein Slawenkongress in Prag statt und einige Wochen nach der Niederlage von Königgrätz hielten die Vertreter der slawischen Nationalitäten in Wien einen Kongress ab.
Bei der Beurteilung des Nationalitätenkonfliktes ist auch zu berücksichtigen, dass bei der Analyse dieses Problemfeldes im Zeitalter Franz Josephs nicht der im Westeuropa verbreite "subjektive", sondern der "objektive" Nationenbegriff zur Anwendung gebracht werden muss. Der "subjektive" Nationenbegriff geht dabei vom einzelnen Subjekt mit dem Bekenntnis zu einer Nation (und oft damit verbunden zu einem Staate z. B. USA etc.) aus, während der "objektive" Nationenbegriff seine Definition durch Faktoren wie Sprache, Kultur, Territorium, Religion etc. erhält.
Wenn sich auch die Gesamtstaatsidee der österreichisch-ungarischen Monarchie langfristig gegenüber dem "subjektiven" Nationenbegriff durchzusetzen vermochte, so konnte jedoch das Erzhaus Habsburg dem aufkeimenden Partikularismus der einzelnen Kronländer keinen nennenswerten Gewichtsausgleich mehr entgegensetzen. Nur die Dynastie selbst – wenn auch mit "starker deutscher Note", die Armee und die Bürokratie fühlten sich noch der österreichischen Gesamtstaatsidee verbunden.
Nach den Niederlagen von Solferino (1859) und Königgrätz (1866) konnten vom Absolutismus die nationalen Strömungen nicht mehr vollständig unterdrückt werden, sodass die Herrschaft nicht nur die "österreichischen Deutschen" umfasste, sondern auf eine breitere Basis gestellt werden musste, d.h. das Staatswesen auf die beiden politisch stärksten Nationen – die Österreicher im Westen und Ungarn (Magyaren) im Osten – beinhaltete.
Beim sogenannten "Ausgleich" von 1867 wurden die Interessen der Tschechen, die sich den Magyaren ebenbürtig sahen, insoweit nicht berücksichtigt, als ihrer Meinung nach die Streitpunkte, die schon 1848 aufgetaucht waren, nach wie vor offen blieben. Dazu gehörten Fragen wie Föderalismus versus Zentralismus, Einheit der böhmischen königlichen Ländereien, historisches Recht auf eigenen Staat (Böhmisches Staatsrecht - verschiedene mittelalterliche und frühneuzeitliche Landesordnungen), Schutz des Rechtes auf eigene Kultur für alle Volksgruppen sowie Ausbau des Wahlrechts.
Im öffentlichen Bewusstsein entstanden entlang dieser "Böhmischen Frage" unüberwindbare Bruchlinien zwischen den deutschen und tschechischen Nationalitäten; diese Kontroverse erreichte mit der "Badeni‘schen Sprachenverordnung" im Jahre 1897 – dem Versuch in den böhmischen Ländern eine Sprachengleichheit herzustellen – den ersten Höhepunkt, um dann in offene Feindschaft umzuschlagen.
Einen Vorgeschmack des nationalen Sprachenstreites lieferte unter dem Kabinett des Fürsten Alfred III. Windischgrätz auch der untersteirische "Fall Cilli", bei dem es um die von der slowenischen Volksgruppe geforderte Errichtung slowenischer Parallelklassen an der Unterstufe des deutschen Gymnasiums in der untersteirischen Stadt Cilli (Celje) ging. Da die deutschen Bürger dieser Kleinstadt von einer fast vollständig geschlossen slowenischen Bevölkerung umgeben waren, befürchteten sie eine Slowenisierung des Gymnasiums bzw. Unterwanderung der Stadt. Die ablehnende Haltung sollte sich dann auch in der Politik auf Ministerratsebene widerspiegeln, denn durch den Austritt aus der Koalition der Vereinigten Linken im Jahre 1895 demissionierte Ministerpräsident Windischgrätz.
Slowaken
Nach dem staatsrechtlichen Ausgleich des Jahres 1867 sollte sich die Lage der Slowaken im ungarischen Staatsverband nicht verbessern. In der ungarischen Reichshälfte war man nicht bereit die Sicherstellung der nationalen Eigenständigkeiten der Slowaken, Serben, Slowenen, Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen etc. zu gewährleisten, wenngleich die Magyaren in ihrer Reichshälfte eine radikale nationale Politik verfolgten, die eine Magyarisierungswelle zur Folge hatte.
Nach der Enttäuschung über die nationale Politik der Magyaren übten sich die slowakischen Politiker in politischer Abstinenz.
Die verschiedenen politischen nationalen slowakischen Strömungen, angefangenen von der bürgerlich-nationalen Bewegung über die Katholische Volksfraktion bis hin zur sozialistischen Bewegung, brachten es jedoch bis zum Ersten Weltkrieg trotzdem nicht zuwege, ein gemeinsames nationales Programm zu erstellen.
Durch den Ausgleich wurde das Kaisertum Österreich wie erwähnt zur österreichisch-ungarischen Monarchie. Der Verlust der Vormachtstellung im deutschen, italienischen bzw. mitteleuropäischen Raum führte zu einer neuen Konstellation im Bereich der Außenpolitik, wobei das Hauptaugenmerk nun in Richtung Osten gelenkt wurde – in jene Richtungen, die wirtschaftlichen und machtpolitischen Spielraum zuließen, insbesondere die Türkei, da der osmanische Einflussbereich im Mittelmeer stetig zunahm.
Neben den nationalstaatlichen Erweckungen von Staaten wie Bulgarien in diesem Gebiet waren es auch die Interessenslagen Russlands, die es zu berücksichtigen galt. Dazu gehörte insbesondere das Protektoratsrecht, welches der Zar als Herrscher im "Dritten Rom" (eine der Bezeichnungen für Moskau) über die christlich-orthodoxe Bevölkerung in Anspruch nahm.
Typisch für die politische Haltung bzw. Einstellung der Verwaltung und Gesetzgebung der deutschliberalen Regierung in "Cisleithanien" in den Jahren 1861 bis 1879 war die an eine "Polizeistaatsmaxime" erinnernde Devise "Alles für die Völker, nichts durch die Völker".
Eine Entschärfung des Nationalitätenkonfliktes erfolgte durch die Einführung des gleichen und allgemeinen Wahlrechts im Jahre 1907 durch die Regierung Max Wladimir (Freiherr von) Beck (1854–1943), dem es gelang, den Völkern Österreichs durch ein neues Wahlrecht eine Kompromisslösung vorzulegen.
Die nationale Schlüsselverteilung erfolgte auf proportionaler Basis aufgrund wirtschaftlicher, kultureller und politischer Macht, sodass für einen parlamentarischen Sitz für die italienische Volksgruppe 38.000 Stimmen, die Deutschen 40.000, die Rumänen 46.000, die Slowenen 50.000, die Polen 52.000, die Kroaten und Tschechen 55.000 und die Ruthenen (Ukrainer) 102.000 notwendig waren.
Trotz all dieser Bemühungen war das Nationalitätenproblem der Donaumonarchie keineswegs gelöst, weshalb sie sich letztendlich als nutzlos herausstellten und somit den Ausbruch des Ersten Weltkriegs nicht verhindern konnten.
Die Ermordung des Ministerpräsidenten Karl Graf Stürgkh (1916)
Am Nachmittag des 21. Oktober 1916 wurde Ministerpräsident Karl Graf Stürgkh (1859–1916), ein gebürtiger Steirer, im Café Meißl & Schadn vom Schriftsteller und sozialdemokratischen Parteisekretär Friedrich Adler (1879–1960), einem Sohn des Parteigründers Victor Adler (1852–1918), erschossen.
Hintergrund dieses politisch motivierten Attentats war der Widerstand gegen den sogenannten "Kriegsabsolutismus" durch den sogenannten "Diktaturparagraphen": Der Reichsrat – als Parlament der Cisleithanischen Reichshälfte der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn – war unter Stürgkhs Mithilfe am 16. März 1914 vertagt und gleichzeitig der Ausnahmezustand verhängt worden. Als Rechtsinstrument für eine solche Weiterregierung ohne Reichsrat fungierte die sogenannte "Notstandsverordnung" – der § 14 aus der Dezemberverfassung von 1867.
Die Abgeordneten zum Reichsrat sollten bis Mai 1917 – als Kaiser Karl selbst die Wiederzusammenkunft anordnete – nicht mehr im Hohen Haus erscheinen.
Diese Verfassungskrise ist unter der Benennung "Kriegsabsolutismus" in die Annalen eingegangen.
Nach der Ermordung Stürgkhs wurde Friedrich Adler vom Ober des Lokals, einem ausgebildeten Ringer, festgehalten und ließ sich widerstandslos verhaften. Er zeigte vor Gericht keine Reue und wurde zum Tode verurteilt, jedoch wurde das Urteil nicht vollstreckt. Unter Kaiser Karl I. (1887–1922) wurde die Strafe zu 18 Jahren schweren Kerker umgewandelt und der Angeklagte in die Strafanstalt Stein überstellt, wo ihm eine bevorzugte Behandlung zuteilwurde. Durch die Amnestie des Kaisers konnte Adler am 2. November 1918 als freier Mann Wien betreten.
Tod des Kaisers
Am 21. November 1916 starb Kaiser Franz Joseph I. um 21.05 Uhr im 87. Lebensjahr im Schloß Schönbrunn. Er hat, was die Länge seiner Regierung betrifft, mit 68 Jahren Regentschaft alle anderen Monarchen der Dynastien in den Schatten gestellt.
Sechs Tage nach dem Todeseintritt wurden die sterblichen Überreste Franz Josephs von Schönbrunn in die Hofburgkapelle überführt und auf einem offenen Totenbett – bekränzt von der ungarischen Königkrone und der österreichischen Kaiserkrone und mit einem Rosenkranz zwischen den Fingern – aufgebahrt, um der Öffentlichkeit bzw. dem Volk die Möglichkeit zum Abschied am offenen Sarg zu geben.
Nach dem feierlichen Requiem im Dom zu Sankt Stephan wurde der Kaiser in der Kapuzinergruft beigesetzt.
Kaiser Franz-Joseph in der Steiermark
Kaiser Franz Joseph I. besuchte vom 2. bis 14. September 1856 mit seiner jungen Gemahlin Elisabeth die Länder Steiermark und Kärnten. Bei der Rückreise nach Wien sollte das Kaiserpaar drei Tage in Graz - ab 11. September verbringen. Das Kaiserpaar wurde am Grazer Bahnhof vom Statthalter der Steiermark, Michael Graf Strassoldo und dem Grazer Bürgermeister, Dr. Johann Edler von Ulm, empfangen.
Kaiser Franz-Joseph in der Steiermärkischen Landesbibliothek
Anfang Juli 1883 reiste Kaiser Franz Joseph I. anlässlich der 600jährigen Verbindung des Landes Steiermark mit dem Habsburgerreich wiederum an die Stadt an der Mur. Am 4. Juli stattete seine kaiserliche Hoheit auch der Steiermärkischen Landesbibliothek einen Besuch ab und verewigte sich im Gästebuch des Hauses.
Ein Beitrag von Dr. Günther Perchtold
Literatur
Thomas C. Arbeiter: Zur Fünfzigjahres-Erinnerung an die Reise Ihrer Majestäten Kaiser Franz Josef I. und Kaiserin Elisabeth von Österreich durch Kärnten und Steiermark im September 1856, Graz 1906
Sign.: A 516791 II Das Buch online zum Durchblättern >>
Das Buch online zum Durchblättern >>
Ilsebill Barta-Fliedl, Markus Langer, Marlene Ott-Wodni, Das kaiserliche Jagdhaus Mürzsteg, Wien [u.a.] 2016
Sign.: LA 567682 III
Jean Paul Bled: Franz Joseph "Der letzte Monarch der alten Schule". Wien, Köln, Graz, 1988
Sign.: L 32 744307 II
Raymond Chevrier: Sissi. Das Leben der Kaiserin Elisabeth von Österreich, Güterloh
Sign.: 288146 II
Egon Caesar Corti: Mensch und Herrscher. Wege und Schicksale Kaiser Franz Josephs I zwischen Thronbesteigung und Berliner Kongress, Graz, Wien, 1 Aufl. 1952
Sign.: C 175946 I
Christian Dickinger: Franz Joseph I.. Die Entmythisierung, Wien 2001
Sign.: L32 760716 I
Franz Herre: Kaiser Franz Joseph von Österreich. Sein Leben seine Zeit, München 1981
Sign.: 601156 I/78
William M. Johnston: Österreichische Kultur- und Geistesgeschichte. Gesellschaft und Ideen im Donauraum, 1848 bis 1938, Wien, Graz 1974.
Sign.: 601158 II/1
Martin Rüdiger u. Martin Günther: In den Jagdrevieren auf den Spuren der Habsburger, Wien 1994
Sign.: L31.04 749864 III
Michaela Vocelka, Karl Vocelka: Franz Joseph I., Kaiser von Österreich und König von Ungarn. 1830-1916, München 2015
Sign.: L 31.04 762601 I
Martina Winkelhofer: Der Alltag des Kaisers. Franz Joseph und sein Hof. Innsbruck, 2010
Sign.: L 31.04 762601